12. Dezember 2023Peter Pionke
„Batterien immer aufladen, wenn man wach ist“
 Prof. Dr. Roland Goertz vom Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz – © UniService Transfer
Prof. Dr. Roland Goertz vom Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz – © UniService TransferAutor Uwe Blass hat sich im Rahmen der beliebten Uni-Reihe „Transfergeschichten“ mit Prof. Dr. Roland Goertz vom Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz über das aktuelle Thema ’sicherer Umgang mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien und professioneller Hilfe im Brandfall‘ unterhalten.
Prof. Dr. Roland Goertz leitet den Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz an der Bergischen Universität und beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Phänomen. „Man kann mit Lithiumbatterien gut und sicher umgehen“, sagt der versierte Wissenschaftler.
 © Bergische Universität
© Bergische UniversitätDurch seine langjährige Erfahrung als Leiter zweier Berufsfeuerwehren kennt er die unterschiedlichsten Brandgefahren ganz genau, leitet dazu diverse Projekte an der Hochschule, hält international Vorträge und wird als geschätzter Gutachter bei aktuellen Brandkatastrophenlagen zu Rate gezogen.
Lithium in primären und sekundären Batterien
„Das Wort Lithium kommt vom griechischen Lithos und bedeutet: der Stein“, erklärt Goertz vorweg. „Es ist das drittkleinste Element im Periodensystem und im Universum. In der Entstehungsgeschichte der Elemente des Universums ist es eines der ältesten Elemente, die wir haben.“
Da es auch gleichzeitig das leichteste Metall von allen ist, finden wir es heute in vielen Batterien. Doch das chemische Element kommt sowohl in primären als auch als sekundären Lithiumbatterien vor, und das ist wichtig zu wissen, denn die primären Batterien lassen sich nicht wieder aufladen.
„Durch die Anglisierung – im englischen gibt es nur den Begriff ´battery`- sagt man heute in allen Fällen Batterie, meint aber bei den Lithium-Ionenbatterien die Akkumulatoren. Die primären Lithiumbatterien sind dann die Metallbatterien. Sie sind nicht wiederaufladbar, hängen z. B. in Wärmezählern an der Heizung oder an anderen Stellen. Da ist metallisches Lithium drin, dass im Laufe der Zeit abreagiert und dann die Spannung bereitstellt“, sagt der Fachmann.
 Lithium-Batterien – wie sie jeder kennt – © Pixabay
Lithium-Batterien – wie sie jeder kennt – © PixabayAnders verhält es sich bei den wiederaufladbaren sekundären Batterien. „Die wiederaufladbaren Lithiumionenbatterien enthalten im Grunde gar kein metallisches Lithium. Da schiebt sich das Lithium beim Auf- und Entladen durch einen Separator immer hin und her und bildet an der Anode meist graphitiertes Lithium.“
Den wiederaufladbaren Batterien gilt daher die hauptsächliche Aufmerksamkeit des Lehrstuhlinhabers, denn im Zuge der Digitalisierung häufen sich Brandgefahren in diesem Bereich und es gilt, Feuerwehren und Nutzende mit plausiblen Maßnahmen zur etwaigen Brandbekämpfung vertraut zu machen.
Trotz aller Unkenrufe: Wasser ist immer noch das Beste
Seit 2007 beschäftigt sich Goertz bereits im vorbeugenden Brandschutz bei Brandereignissen mit Lithiumionenbatterien und sagt: „Man braucht immer Wasser! Diese übergroße Vorsicht, metallisches Lithium nicht mit Wasser zu behandeln, steckt immer noch in den Köpfen drin, aber es ist am Ende so, dass bei den wiederaufladbaren Batterien, Wasser das Beste ist.“
Damit es aber gar nicht erst zu einer Entzündung kommt, können Nutzer wiederaufladbarer Batterien im Regelfall schon vorbeugen. „Lithiumionenbatterien, oder generell solche Geräte, die aufgeladen werden müssen, sollte man immer nur dann aufladen, wenn man wach und aufmerksam ist, möglichst nicht über Nacht“, erklärt Goertz und betont, dass bei den weltweit Milliarden Auflade- und Entladeprozessen innerhalb von 24 Stunden, eigentlich wenig passiere.
Wichtig sei, erklärt der Chemiker, es immer dann zu machen, wenn man es im Auge behalten könne und nur dort zu laden, wo, wenn etwas passieren würde, möglichst wenig Schaden entstehen könne.
 Ein Tablet wird aufgeladen – © UniService Transfer
Ein Tablet wird aufgeladen – © UniService TransferProf. Goertz: „Nehmen wir mal einen Pedelec Akku. Der sollte nicht auf einem Kissen oder anderen isolierenden Materialien aufgeladen werden, weil bei der Wärmeabgabe immer auch ein Brand entstehen könnte. Das macht man dann in der Garage oder auf dem Balkon. Und wenn das nicht geht, irgendwo da, wo kein brennbares Material liegt und vor allem immer dann, wenn man nicht schläft.“
Auf der Suche nach geeigneten Löschmitteln
Wasser sei nach wie vor das beste Löschmittel, erklärt Goertz. „Man kann sicher dem Wasser noch ein paar Zusätze beifügen, also Tenside, damit es besser eindringen kann, so dass die Oberflächenspannung reduziert wird. Ich habe auch schon Experimente gemacht, wo man dem Wasser Calciumsalze zugefügt hat, damit die bei der Batteriezersetzung freiwerdende Flusssäure besser gebunden wird.“,
Er fährt er fort, und auch Schäume würden eingesetzt, wobei der Einsatz mit oft ökotoxischer Wirkung im Zuge des Umweltschutzes intensiv diskutiert werde. „Da arbeiten wir auch an einem Forschungsprojekt für das Umweltbundesamt, wo es um den Austausch dieser Schäume geht.“
Erste Hilfe in den eigenen vier Wänden: Feuerlöschspraydosen
„Die Lithiumionenbatterien in den Haushalten sind eine Zündquelle und können Brandursache sein“, erklärt der Wissenschaftler und empfiehlt generell für das eigene Heim eine Feuerlöschspraydose. „Der Feuerlöscher ist für Zuhause eigentlich zu groß und dem einen oder anderen auch zu teuer“, erklärt Goertz.
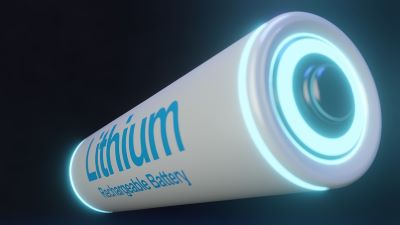 Eine handelsübliche Lithium-Batterie – © Pixabay
Eine handelsübliche Lithium-Batterie – © PixabayZudem sei ein Löscher mit einer regelmäßigen Wartung verbunden. So eine Spraydose könne man drei bis fünf Jahre nutzen. Für den Adventskranzbrand reiche sie hervorragend und funktioniere auch bei den Lithiumakkus.
„So richtig löschen kann man die ja nicht, sondern es geht immer nur darum, wenn mehrere Zellen in einem Modul verbaut sind und eine Zelle geht durch, dass man dann die Verbreitung verhindert oder reduziert und als Erstickungseffekt nutzt“, erläutert er. „Wenn der komplette Akku wirklich durchgeht, dann verläuft das so schnell, das kann man gar nicht stoppen, denn da haben wir schnell Temperaturen von 1000 Grad.“
Feuerwehren sind gut auf Gefahrenlagen vorbereitet
Roland Goertz ist auch Direktor des Feuerwehrwissenschaftlichen Instituts (FSI) an der Bergischen Universität, einem Kompetenzzentrum für die Forschung im Bereich der naturwissenschaftlichen, technischen und organisatorischen Aspekte der Feuerwehr sowie der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr.
Die Bedarfsplanung bundesdeutscher Berufsfeuerwehren sei gut und habe sich im Laufe der Jahre positiv entwickelt, sagt er. „Wir sind ja auch immer wieder bei den Feuerwehren in der wissenschaftlichen Begleitung ihrer Bedarfsplanung aktiv und haben mit größeren und kleineren Feuerwehren schon Projekte gemacht, in denen wir mit statistischen Methoden geguckt haben, wie die Feuerwehren sich aufstellen können, damit sie rechtzeitig in der richtigen Stärke vor Ort sind.“
 Ein Elektroauto wird aufgelanden – © Pixabay
Ein Elektroauto wird aufgelanden – © PixabayIn einem zusätzlichen Projekt unter dem Titel ´Sicherheit und Wirtschaftlichkeit in der Bedarfsplanung`, finanziert von der Stiftung Zukunft NRW, hat er mit seinem Team diese statistischen Methoden entwickelt.
Bei den Freiwilligen Feuerwehren sei die Ausgangssituation eine andere, denn die aktiven Feuerwehrleute arbeiten nicht unbedingt am Wohnort. Da suche man noch nach geeigneten Lösungen um die sogenannte ´Tagesalarmverfügbarkeit` zu optimieren.
Internationale Gutachtertätigkeit im Schadensfall
Der Brand der Fähre „Freemantle Highway“ im Juli vor Ameland, hat die Welt in Alarmbereitschaft versetzt. Möglicherweise durch eine Lithiumbatterie in einem E-Auto, die sich entzündet hatte, brannte ein Schiff mit knapp 4.000 beladenen PKW. Auch in diesem Bereich gehört Goertz mittlerweile zu einer internationalen Anlaufstelle, denn er beschäftigt sich in einem weiteren Forschungsgebiet auch mit Brandursachenermittlung.
Die Löscharbeiten vor Ameland waren schwierig. Zur Brandursachenermittlung wurde der Wuppertaler Sicherheitstechniker hinzugezogen. „Ich war mittlerweile drei Mal auf diesem großen Car-Carrier-Schiff, der „Freemantle Highway“, erklärt er, kann aber aufgrund der laufenden Ermittlungen keine weiteren Auskünfte geben.
Die generelle Situation eines Brandes auf offener See sei jedoch immer schwierig, denn die Besatzung eines großen Frachters bestehe nur aus einer Handvoll Menschen, von denen auch einige eine Feuerwehrausbildung zur Brandbekämpfung hätten. „Aber nachts um 00.00 Uhr in der dunklen Nordsee ist das alles andere als toll. Da ergeben sich viele Fragen, über die ich auch im letzten Jahr bei einem Vortrag in Chicago gesprochen habe, nämlich, ob man solche Transporte nicht anders technisch schützen muss.“
Es gehe nicht so sehr um die Abwehr, denn auf einem Car-Carrier-Schiff habe man überhaupt keinen Platz, die Autos stünden da dicht an dicht und es komme keiner mit Ausrüstung zur Brandbekämpfung durch. „Auch bei einem Containerschiff, wenn da unten in einer Ladeluke einer der Container anfängt zu brennen, kommt man nicht ran. Es stellt sich also eher die Frage, ob die installierte Löschanlagentechnik auch richtig funktioniert und Einfluss auf das Brandgeschehen habe?“
Gefahrenabwehrmanagement bei Unfällen mit Elektrofahrzeugen
Goertz ist ein Befürworter einheitlicher, bundesweiter Vorgehensmaßnahmen im Brandfall und hat bereits mit einer Arbeitsgruppe, unter Federführung der Berliner Feuerwehr, die für alle 16 Bundesländer eine Art einheitliches Vorgehen bei Unfällen mit Elektrofahrzeugen vorschlägt, einem Workshop in Wuppertal durchgeführt.
Den Unterschied beim Vorgehen im Brandfalle eines Normal-PKW-Unfalls im Vergleich zu einem E-Auto-Unfall erklärt Goertz folgendermaßen: „Sie kommen auf die Autobahn, es ist jemand im Auto eingeklemmt und liegt schwer verletzt in seinem PKW. Sie versuchen dann, die Person da herauszukriegen. In der Vergangenheit schaute man dann, ob Kraftstoff ausläuft und ob eine Explosionsgefahr besteht. Jetzt ist es so, wenn das Elektroauto noch nichts macht, dann ist es zwar erst einmal ruhig und friedlich, aber durch den mechanischen Stoß auf die Batterie ist die Batterie möglicherweise in einem kritischen Zustand und kann jeden Augenblick ins Thermische übergehen. Dann ist die Frage, wie kann man jetzt den Menschen retten, obwohl jeden Augenblick aus der Batterie schlagartig in großen Mengen giftige und brennbare Gase austreten können?“
Zur Menschenrettung aus Elektrofahrzeugen hat Prof. Goertz auch schon für den ADAC ein Forschungsprojekt durchgeführt. Er diskutiert immer wieder mit den Feuerwehren und spielt Szenerien durch, um zu plausiblen Maßnahmen zu gelangen.
Akkus gehören nicht in die normale Mülltonne
Die Entsorgung all dieser Akku-Geräte stellt ein weiteres Sicherheitsrisiko dar, denn die Teile gehören nicht in die Mülltonne. „Die müssen natürlich in die entsprechenden Sammelbehälter“, sagt Goertz. „Wir beschäftigen uns im Forschungsprojekt SUVEREN2USE mit der gesamten Wertschöpfungskette der Lithiumionenakkus, also von der Herstellung über die Verwendung, Lagerung bis zur Entsorgung und auch bis zum Schadensfall.“
 Ein Akku an der Ladestation – © UniService Transfer
Ein Akku an der Ladestation – © UniService TransferEbenso breit ist die Liste der Kooperationspartner, die u.a. aus Entsorgerbetrieben und Löschanlagenherstellern bestehen. Und auch mit einer Weiterverwendung nicht mehr funktionstüchtiger E-Autobatterien beschäftigt sich sein Team. „Wir haben mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) ein Projekt zum Thema ´Weiterverwendung von Lithiumionenbatterien` gemacht. Wenn die in Elektrofahrzeugen weniger als 80 Prozent der Kapazität leisten, sind sie für Fahrzeuge eigentlich nicht mehr gut nutzbar, können aber in einem stationären Betrieb noch gut eingesetzt werden.“
Vor allem bei der falschen Entsorgung von Lithiumbatterien kommt es immer wieder zu Brandfällen. „Ich mache ja auch Brandursachenermittlung und hatte schon Fälle in solchen Abfallsortieranlagen. Das sind die sogenannten Fehlwürfe, also, wenn Menschen leider dummerweise irgendwelche Lithiumbatterien, Geräte mit Batterien oder diese „nervigen“ Glückwunschkarten, die beim Öffnen eine Melodie erklingen lassen, in die normale Mülltonne entsorgen. Dann ist da eine Batterie, die in den Abfallsortieranlagen geschreddert wird und zu brennen anfängt. Diese Fehlwürfe sind ein sehr großes Problem.“
Daher seine Bitte an alle Nutzerinnen und Nutzer : „Batterien sollte man immer in den Geschäften, die Sammelboxen haben, abgeben. Das ist der normale und sichere Weg, der auch in der Regel gut funktioniert.“
Uwe Blass
 Prof. Dr. Roland Goertz – © UniService Transfer
Prof. Dr. Roland Goertz – © UniService TransferÜber Prof. Dr. Roland Goertz
Prof. Dr. Roland Goertz leitet seit 2012 den Lehrstuhl für Chemische Sicherheit und Abwehrenden Brandschutz in der Fakultät für Maschinenbau und Sicherheitstechnik der Bergischen Universität.
Weiter mit:




Kommentare
Neuen Kommentar verfassen