29. September 2025Peter Pionke
Bedrohung und Gewalt gegen öffentliche Personen
 Prof. Dr. Peter Imbusch, Soziologe an der Bergischen Universität – © Uniservice Third Mission
Prof. Dr. Peter Imbusch, Soziologe an der Bergischen Universität – © Uniservice Third MissionSie haben zusammen mit Ihrem Mitarbeiter Joris Steg ein Buch mit dem Titel ‚Bedrohungsanalysen` herausgebracht, in dem sie das aktuell brandheiße Thema der Angriffe auf Politikerinnen, Journalistinnen, Einsatzkräfte und Lehrpersonen thematisieren. Wie sind Sie dazu gekommen?
Peter Imbusch: „In den letzten Jahren haben Bedrohungen und Gewalt gegen Politiker und andere öffentliche Personenkreise medial und wissenschaftlich immer mehr Aufmerksamkeit gewonnen. Das hat uns dazu geführt, dass wir selbst eine kleine Studie zur Situation von Lokalpolitikern im Bergischen Städtedreieck durchgeführt haben, die mit wenigen Abweichungen den großen Trend der Zunahme von Bedrohungen und Gewalt bestätigt hat. In der intensiveren Beschäftigung mit der Thematik ist aber rasch aufgefallen, dass nicht nur Politiker von Drohungen und Gewalt betroffen sind, sondern auch andere öffentliche Personenkreise, wie z.B. Journalisten, Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst, Lehrer und Wissenschaftler, Ärzte und medizinisches Fachpersonal. Mit dem Buch wollten wir die bisherigen, häufig disparaten Ergebnisse zusammenführen und genauer wissen, wie es um die Bedrohungslagen wirklich bestellt ist. Es war eigentlich klassische wissenschaftliche Neugier, die uns angetrieben hat, das Buch zu machen.“
 © Bergische Universität
© Bergische UniversitätSie sprechen im Untertitel auch von der Gefahr für die Demokratie. Können Sie das mal erklären?
Peter Imbusch: „Wie man auch immer zu den oben genannten Personenkreisen stehen mag, kann man doch nicht leugnen, dass sie für unser Gemeinwesen eminent wichtige Funktionen erfüllen, die für das gedeihliche Miteinander und eben auch eine lebendige Demokratie unerlässlich sind. Wenn beispielsweise Politiker bedroht werden, engagieren sie sich eventuell weniger in den politischen Gremien, tragen politischen Streit weniger offen aus oder ziehen sich ganz aus der Politik zurück. Der negative Effekt auf politische Neuankömmlinge ist ebenfalls verheerend, wenn etwa neue Abgeordnete damit rechnen müssen, angegriffen oder (samt ihrer Mitarbeitenden und Familien) bedroht zu werden.
Unsere liberale Demokratie lebt vom politischen Engagement möglichst vieler Bürger und vom diskursiven Streit um das bessere Argument. Bedrohungen und Gewalt zerstören im Grunde nicht nur die Fundamente der Demokratie als Ordnungsform, sondern auch als Lebensform, die wir alle schätzen. Ähnliches ließe sich auch für die anderen bedrohten Gruppen zeigen. Liberale und pluralistische Demokratien leben zwar durchaus vom politischen Konflikt und politische Parteien auch von der Gegnerschaft, aber weder kann Gewalt dabei ein Mittel der politischen Auseinandersetzung und der diskursiven Aushandlung von Interessen sein, noch sollten Gegnerschaft und Konkurrenz als Feindschaft und gewaltsame Auseinandersetzung missverstanden werden.
Die Angriffe richten sich u.a. auch an Lehrkräfte in Schulen und Universitäten. Gerade in den letzten Tagen gab es dazu wieder ein trauriges Beispiel aus Essen. Welche Institutionen bieten denn da Hilfe an?
Peter Imbusch: „Das ist in der Tat ein großes Problem. Grob gesagt gibt es zwei Perspektiven: Für manche der Berufsgruppen haben die entsprechenden Berufsverbände angesichts der anhaltenden Bedrohungslage inzwischen besondere und je spezifische Handreichungen für den Selbstschutz der Personen mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen verfasst. Die müssten dann in den jeweiligen Institutionen umgesetzt werden. Für einige wenige der Personengruppen gibt es aber auch übergeordnete Meldestellen und Portale, die Hilfsangebote machen. In unserem Buch beschäftigen wir uns deshalb auch ausführlich mit der Frage, was denn gegen Bedrohungen und Gewalt getan werden kann. Manchmal ist der Weg zur Polizei zwingend, der aber in vielen Fällen von Bedrohungen und Gewalt gar nicht so häufig beschritten wird. Da gibt es noch ein großes Dunkelfeld.“
Was sind denn die gesellschaftlichen Ursachen und Hintergründe der zunehmenden Bedrohung von öffentlichen Personenkreisen?
Peter Imbusch: „Bei Gewalt und Bedrohungen gegen öffentliche Personenkreise handelt es sich ganz offensichtlich um ein gesellschaftliches Phänomen, welches mit Einzelfallbetrachtungen und individuellen Zuschreibungen an bestimmte Täter oder Täterinnen nur unzureichend erfasst werden kann. Trotz der manchmal disparat wirkenden Ereignisse scheint es doch gemeinsame Ursachen und Hintergründe für die zunehmende Bedrohung von öffentlichen Personenkreisen zu geben. Denn die Anfeindungen, Aggressionen und Angriffe resultieren grob gesagt aus verschiedenen sozioökonomischen (z.B. Krisen, Konflikte, soziale Ungleichheit), politischen und kulturellen (z.B. dem Erstarken von Rechtspopulismus, Autoritarismus und Nationalismus, Wutprotesten, politischer Entfremdung und sinkendem Institutionenvertrauen) sowie medialen Aspekten (z.B. der Wirkungsweise und den Funktionsprinzipien der sozialen Medien), die nicht isoliert voneinander betrachtet werden dürfen, denn sie verbinden, überlappen, beeinflussen und verstärken sich wechselseitig.
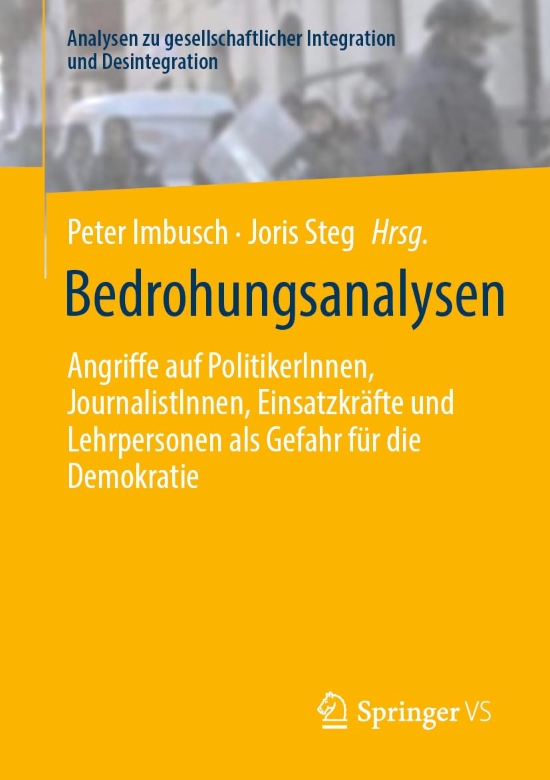 Bedrohungsanalysen – Peter Imbusch & Joris Steg – Verlag Springer VS Erscheinungstermin : 17. November 2025 Sprache – 520 Seiten – ISBN-10 : 365848151X – ISBN-13 : 978-3658481513
Bedrohungsanalysen – Peter Imbusch & Joris Steg – Verlag Springer VS Erscheinungstermin : 17. November 2025 Sprache – 520 Seiten – ISBN-10 : 365848151X – ISBN-13 : 978-3658481513Hinzu kommen bei einzelnen Berufsgruppen noch individuelle, akzidentielle, situative und berufsspezifische Gründe und Motive für Bedrohungen und Gewalt. Die zunehmende Gewalt gegen öffentliche Personenkreise ist also ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, welches sich einfachen linearen Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen entzieht. Die Gewalt gegen öffentliche Personenkreise entsteht nicht im luftleeren Raum. Erst wenn wir diese Aspekte zusammen in den Blick nehmen, sehen wir in der Gesellschaft die Entregelungen, Entstrukturierungen und Enthemmungen, die das Phänomen der gesellschaftlichen Ursachen und Hintergründe der zunehmenden Gewalt gegen öffentliche Personenkreise einsichtig machen.“
Wie stark ist denn in diesem Zusammenhang die Bedrohung und Gewalt von rechts?
Peter Imbusch: „Wenn wir uns die Tätergruppen anschauen, dann muss man natürlich sagen, dass diese heterogen und nicht einheitlich sind – das wäre für so unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen auch seltsam. Gleichwohl gibt es Muster für die einzelnen bedrohten Personenkreise: So werden etwa Politiker ganz überwiegend von rechtsextremen oder rechtspopulistischen Kräften angegriffen – obwohl die AfD und ähnliche Parteien immer das Gegenteil insinuieren und sich selbst gerne als das größte Opfer darstellen. Das gleiche trifft für Journalisten zu, die in den letzten Jahren hauptsächlich das Opfer von rechten Gruppen, Wutbürgern und Querdenkern wurden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste haben es mit einer diffuseren Tätergruppe zu tun.
Und bei Ärzten und Krankenhauspersonal sind es in der Regel die zu behandelnden Kranken selbst oder deren Angehörige, die für Ärger sorgen. Man wird die Frage wahrscheinlich berufsgruppenspezifisch und auch situativ beantworten müssen. Schaut man jedoch in die polizeilichen Kriminalstatistiken, dann kommt etwa das Gros der politisch motivierten Kriminalität ganz eindeutig von rechts; diese Formen der Gewalt haben in den letzten Jahren auch am deutlichsten zugenommen. Die Gefahr droht hier ganz eindeutig vom rechten Rand der Gesellschaft!“
Sie schreiben von empirischen Untersuchungen, die Bedrohungsfelder analysiert und Täterstrukturen rekonstruiert haben. Woher kommen denn potentielle Täter?
Peter Imbusch: „Das ist in dieser Allgemeinheit nicht so leicht zu sagen. Im Buch haben wir unterschiedliche Tätergruppen identifiziert. Die bisherigen empirischen Untersuchungen beschäftigen sich überwiegend mit den Gewaltvorfällen selbst und deren Häufigkeit, ggf. noch mit möglichen Gegenmaßnahmen. Sie zeigen zunächst, wer wie und in welchem Umfang von Drohungen und Gewalt betroffen ist. Dabei stehen richtigerweise die Opfer im Mittelpunkt. Nur wenige Studien lassen sich über die möglichen Täter aus.
Und wenn sie das tun – etwa durch die Befragung und Aussagen der Opfer –, dann ergibt sich das oben aufgezeigte, aber unvollständige Bild der Bedrohungslage. Manchmal agieren die Täter auch aus der Anonymität heraus; manchmal kann man ihnen nicht habhaft werden. Da gibt es viele Probleme. Hinzu kommt, dass nur ein Bruchteil der Bedrohungen und Gewaltvorkommnisse gegen die öffentlichen Personenkreise überhaupt zur Anzeige gebracht und somit justiziabel wird. Die Gründe dafür sind wiederum vielschichtig – und selbst ein Problem.“
Welche Handlungsoptionen oder Gegenstrategien gibt es denn und wer formuliert die?
Peter Imbusch: „Handlungsoptionen gegen Gewalt und Bedrohungen wirken leider immer nur eingeschränkt. Nicht zuletzt deshalb ist es für unsere liberale Gesellschaft so wichtig, dass wir möglichst gewaltfrei miteinander umgehen. Häufig schützen sich die betroffenen Personenkreise selbst, indem sie Vorsichtsmaßnahmen für sich und ihr Umfeld ergreifen. Das reicht von der Etablierung von Sicherheitsarchitekturen bis hin zum Erlernen von Selbstverteidigungsmaßnahmen und der Verinnerlichung von deeskalierenden Sprachregelungen. In Behörden und Ämtern werden durch bauliche Maßnahmen oder Sicherheitsvorkehrungen gewalttätige Bürger auf Distanz gehalten.
Es gibt aber auch bedrohte Gruppen, für die persönliche Nähe unvermeidbar ist, wie etwa die Polizei und der Rettungsdienst, Journalisten, Ärzte, Krankenhauspersonal, die müssen schlicht mit Vorsicht und Umsicht ihre Tätigkeiten ausüben. Die Handreichungen gegen Bedrohungen und Gewalt stammen, wie gesagt, aus den eigenen Organisationen, von Landesregierungen oder von institutionellen Hilfeeinrichtungen, die sich auf solche Abwehrmaßnahmen spezialisiert haben.“
Sie haben zu diesem Thema am 06.10.25 eine Tagung an der Bergischen Universität organisiert, die sich dem Thema Bedrohung, Angriffe und Gewalt in Bezug auf die Wissenschafts- und Pressefreiheit widmet. Wie dramatisch schätzen Sie die Lage denn ein?
Peter Imbusch: „Bei einem oberflächlichen Blick könnte man mit Gelassenheit reagieren. Wissenschafts- und Pressefreiheit sind verfassungsrechtlich verbürgt und gelten als essentiell für eine funktionierende Demokratie. Doch bei genauerem Hinsehen muss man sich durchaus Sorgen machen: Journalisten werden vielfach eingeschüchtert, in ihrer Arbeit behindert, bedroht oder gewaltsam traktiert, insbesondere wenn sie investigativ unterwegs sind oder vermeintlich heikle Themen aufgreifen. Das geschieht nicht nur seitens rechter Gruppierungen aus der Gesellschaft heraus, sondern manchmal auch durch den Staat und seine Organe. In seriösen Rankings der Pressefreiheit ist die Bundesrepublik in den letzten Jahren nach unten gerutscht.
Das sollte uns insbesondere im Hinblick auf die Presse als sog. ‚vierte Gewalt‘ beunruhigen. Und Wissenschaftler werden in der Regel zwar weniger körperlich angegriffen, aber hier haben wir in den letzten Jahren ebenfalls eine Zunahme von Verleumdungen, Bedrohungen, Ehrabschneidungen, Relativierungen von unliebsamen Forschungsergebnissen oder gar eine regelrechte Wissenschaftsfeindlichkeit erlebt – also das, was man gemeinhin epistemische Gewalt nennt. Und davor liegen dann noch die unterschiedlich gearteten Cancel Culture-Phänomene von rechts und von links. Schaut man sich die rasanten neueren Entwicklungen in den USA oder manchem unserer europäischen Nachbarländer an, dann kann einem schon Angst und bange werden.“
Wir erfahren täglich von den Repressionen, die die amtierende amerikanische Regierung auf die Universitäten ausübt. Ein Referat in ihrer Tagung beschäftigt sich auch mit diesem Thema und fragt: Wie steht es um die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland? Was meinen Sie?
Peter Imbusch: „Die Repressionen der US-amerikanischen Regierung gegen die Universitäten und andere wissenschaftliche Einrichtungen sind völlig indiskutabel und brandgefährlich. Sie dienen dazu, enge Denkkorridore zu schaffen und jedwede freie Wissenschaftsausübung zugunsten einer bestimmten Ideologie zu unterbinden. Erschreckend ist es auch zu sehen, wie schnell politischer Druck schwere Schäden anrichten kann. Von solchen Verhältnissen sind wir in Deutschland zum Glück (noch) weit entfernt. Doch für Deutschland würde ich sagen: Wehret den Anfängen! Gerade in den heutigen Krisen- und Konfliktsituationen mit ihrer emotionalisierten und aufgeheizten Öffentlichkeit steht bereits die ein oder andere wissenschaftliche Erkenntnis im Senkel oder kann forschungsmäßig nicht weiterverfolgt werden. Auch in Deutschland haben Feinde der Wissenschaftsfreiheit in den letzten Jahren (bei Wahlen und im öffentlichen Diskurs) beträchtlichen Zulauf erhalten.“
Am gleichen Abend findet zusätzlich eine Podiumsdiskussion um 18.00 Uhr in der CityKirche statt. Lassen Sie mich abschließend mit dem Titel dieser Veranstaltung fragen: Gibt es eine Verrohung der Gesellschaft?
Peter Imbusch: „Wenn wir uns die Fakten und Zahlen anschauen, dann würde ich schon von einer Verrohung der Gesellschaft sprechen. Auf der einen Seite nehmen Bedrohungen und Gewalt allgemein zu, Krisen und Konflikte tragen zu einer Verunsicherung der Bürger bei, die soziale Ungleichheit wächst, das Vertrauen in den Staat und seine Organe sinkt. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Verrohung der politischen Kultur, der Sprache und der Kommunikationsstile, die uns unempfindlich macht, für das Leiden anderer. Wir tragen als Gesellschaft hehre Werte und hohe Normen vor uns her, scheuen uns aber nicht, im Bedarfsfall gegen diese zu verstoßen. Der Level an Humanität sinkt – und manche nutzen das dann, um selbst direkt oder indirekt handgreiflich zu werden. Schaut man sich die Unzivilisiertheiten im gesellschaftlichen Miteinander, die Beleidigungen und Beschimpfungen im Internet an, dann ist man schnell bei eskalierenden sozialen Protesten und roher physischer Gewalt, die sich gegen Mitmenschen oder öffentliche Personenkreise wendet.“
Uwe Blass
 Prof. Dr. Peter Imbusch – © Uniservice Third Mission
Prof. Dr. Peter Imbusch – © Uniservice Third MissionÜber Prof. Dr. Peter Imbusch
Prof. Dr. Peter Imbusch studierte Soziologie, Politikwissenschaften, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte sowie Volkswirtschaftslehre und promovierte zur Sozialstrukturanalyse Lateinamerikas. Er habilitierte sich 2001 mit einer Arbeit über „Moderne und Gewalt“. Seit 2011 lehrt er als Professor für Politische Soziologie an der Bergischen Universität.
Weiter mit:




Kommentare
Neuen Kommentar verfassen