15. September 2025Peter Pionke
Ufa-Wochenschau: Eine geschickt montierte Realität
 Das erste deutsche Wochenschau-Kino in Berlin (September 1931) – © CC BA-SA 3.0
Das erste deutsche Wochenschau-Kino in Berlin (September 1931) – © CC BA-SA 3.0Was wurde denn in solchen Wochenschauen gezeigt?
Georg Eckert: „Die Ufa-Wochenschau bot ein ähnliches Programm wie andere Wochenschauen. Entstanden war das Genre bereits vor dem Ersten Weltkrieg, in dem es einen raschen Ausbau erlebt hatte, als Teil der Kriegspropaganda. Nach dem Krieg wandelten sich die Inhalte. Teils lernten die Produzenten dabei von der nationalen wie internationalen Konkurrenz, teils tauschten sie Material aus, dessen Erstellung ja kostspielig war. Die meist etwa zehnminütigen Ausgaben mit jeweils ca. einminütigen Themen wurden über mehrere Wochen oder sogar Monate gezeigt, so dass sie nicht der Tagesaktualität verpflichtet sein konnten. Ernste Themen wie die große Politik oder technische Entwicklungen kamen darin vor, aber auch weniger ernste, wie Sport und Unterhaltung aller Art – beides konnte auf seine Weise allerdings sogar in höchstem Grade politisch sein, wenn man etwa an die Olympiade des Jahres 1936 denkt –. Bis 1929 lief das gesamte Programm übrigens ohne Tonspur, deren Einführung mit einer Konsolidierung des Marktes einherging.“
 © Bergische Universität
© Bergische UniversitätEine Wochenschau konnte die Massen beeinflussen. Wodurch geschah das denn?
Georg Eckert: „Eine genaue Messung, inwiefern die jeweiligen Wochenschauen meinungsprägend waren, ist nicht möglich, ein Reichweitenvergleich mit Zeitungen und Zeitschriften lässt sich kaum erstellen. Flächendeckend waren die Wochenschauen ohnehin nicht verfügbar und deckten vor allem urbane Ballungsräume ab. Sie erreichten lediglich einen Bruchteil der Kinos. Die Ufa-Wochenschau kam im Jahre 1929 auf 100 Kopien. Dennoch darf man sagen, für die Zuschauer hatten Filmaufnahmen anfangs einen Sensationscharakter, den sie hier ausspielten. Vor der Fiktion des Filmes wurde mit einer Wochenschau im Kino eine geschickt montierte „Realität“ gezeigt, und zwar in einer Eindringlichkeit, die über die gewohnte Aufnahme von Neuigkeiten durch Lektüre weit hinausging: zum Beispiel auch, indem ein Originalton immer mehr hörbar machte, was anfangs nur nachträglich mit Musik oder einer Sprecherstimme unterlegt worden war.“
Eine der ersten deutschen Wochenschauen war die Eiko-Woche, die von 1914 bis 1918 existierte. Die wurde im Ersten Weltkrieg auch zu Propagandazwecken genutzt, oder?
Georg Eckert: „Nicht nur die ab März 1914 erscheinende Eiko-Woche wandelte ihren Charakter nach Ausbruch des Weltkriegs. Von Unterhaltung (die ein besonders raffiniertes Medium politischer Botschaften sein kann) entwickelte sie sich zu aufwendig nachproduzierter Kriegsberichterstattung. Der Krieg war auch ein Medienkrieg. Lehrreich ist der Blick auf zeitgenössische Akteure wie Oskar Messter, der seine Erfahrungen im August 1916 in einem Artikel „Der Film als politisches Werbemittel“ darlegte und für sich in Anspruch nahm, mit seiner seit Oktober 1914 produzierten, später von der Ufa als Ursprung ihrer eigenen Aktivitäten gedeuteten „Messter Wochenschau“ mehr als 34 Millionen Menschen im In- und Ausland zu erreichen. Er rief das Reich dazu auf, mehr Propaganda zu unterstützen: „Jahrelang vorher hat das feindliche Ausland unter Führung Englands uns eingekreist und die Lüge in der Presse und im Film als Kriegsmittel benutzt. Wir haben dem nicht genügend Gleichwertiges, Abwehrendes gegenüberzustellen. Die Hauptsache ist, dass Deutschland endlich einmal etwas Durchgreifendes tut“.
 Dr. Georg Eckert, Historiker an der Bergischen Universität – © Mathias Kehren
Dr. Georg Eckert, Historiker an der Bergischen Universität – © Mathias KehrenAuch ganz praktische Beispiele nannte er, „wie wir uns die Massensuggestion vorstellen. Der Feind behauptet, wir schlachten gewohnheitsgemäß Frauen und Kinder ab, vernichten im Besonderen die Säuglinge. Wir zeigen unsere mustergültigen Einrichtungen für Säuglings- und Kinderheime“.“
Seit 1925 gab es dann die Ufa-Wochenschau, die aber sehr schnell rechtsnational orientiert war. Wie kam das?
Georg Eckert: „Nicht von ungefähr erinnert die Ufa ihrem Namen nach an die Bufa, das im Januar 1917 geschaffene „Bild- und Filmamt“. Eine Behörde war die im Dezember 1917 gegründete Ufa zwar nicht, sondern vielmehr eine gemeinsame Initiative kommerzieller Filmfirmen, die aber ein patriotisches Anliegen teilte. Mit Propaganda ließ sich Geld verdienen, nach Kriegsende allerdings kaum mehr. Das Film-Business stand nunmehr in einem rauhen Wettbewerb. Zumal wegen teurer Produktionen geriet die Ufa am Unterhaltungsmarkt in Schwierigkeiten, die ein fataler Vermarktungsvertrag mit amerikanischen Studios bald noch vermehrte.
Das wirtschaftliche Überleben der Ufa sicherte schließlich im Jahre 1927 ihr Aufkauf durch Alfred Hugenberg, einen vermögenden Montan- und Medienunternehmer, der schon im Ersten Weltkrieg weitreichende Kriegsziele gefordert und im Jahre 1918 zu den Gründern der DNVP (Deutschnationale Volkspartei) gehört hatte, zu deren Vorsitzender er wiederum im Jahre 1928 gewählt wurde. Gleichwohl dominierten nicht parteipolitische Interessen. Ihre größten Erfolge erzielte die Ufa mit unterhaltsamen Tonfilmen wie „Die Drei von der Tankstelle“. Das moderne Frauenbild dieses Films leuchtete auch in Wochenschauen, mochten sie in der Berichterstattung auch nach rechts tendieren.“
Mit Einführung des Tonfilms gab es dann wieder neue Möglichkeiten, aber auch Möglichkeiten der Manipulation. Ab 1935 unterstanden alle Wochenschauen dem Propagandaministerium. Das bedeutete eine verschärfte Zensur, oder?
Georg Eckert: „Das NS-Regime betrieb von Anfang an eine „geistige Mobilmachung“, wie sie Goebbels als Leiter des neueingerichteten „Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda“ betrieb. Das bedeutete teils eine direkte Zensur. Nicht minder wichtig waren aber zwei andere Mechanismen. Verhindert wurden ja nicht nur unliebsame Inhalte, sondern auch missfällige Künstler, sei es wegen ihrer (jüdischen) Herkunft oder wegen ihrer Überzeugungen; umgekehrt schuf dieser Ausschluss auch Aufstiegsmöglichkeiten für Überzeugungstäter wie für Karrieristen, die sich mit erwünschten Themen zu profilieren wussten, sowie Nischen für solche, die sich irgendwie mit dem System zu arrangieren suchten.
Festzustellen sind dabei sowohl ein Ideologisierungs- als auch ein Professionalisierungsschub. Solche Mechanismen belegen die Propagandakompanien der Wehrmacht, die im Zweiten Weltkrieg viel Material für die Wochenschau zulieferten. Darin dienten viele Medienmacher der Nachkriegszeit, zum Beispiel Henri Nannen („Stern“), Manfred Schmidt (Zeichner von „Nick Knatterton“) oder Erich Welter (FAZ): manche eher freiwillig, manche eher unfreiwillig, manche mit mehr, manche mit weniger Begeisterung.“
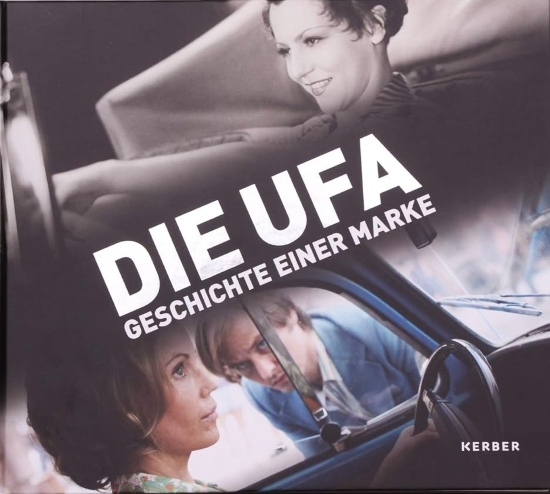 Die UFA – Geschichte einer Marke – Rolf Aurich – Karin Herbst-Meßlinger – Annika Schaefer – KERBER verlag – 200 Seiten – ISBN-10: 3735604218 – ISBN-13: 978-3735604017
Die UFA – Geschichte einer Marke – Rolf Aurich – Karin Herbst-Meßlinger – Annika Schaefer – KERBER verlag – 200 Seiten – ISBN-10: 3735604218 – ISBN-13: 978-3735604017Ab 1940 gab es in Berlin sogar das erste spezielle Wochenschaukino, in dem nur Wochenschauen präsentiert wurden. Die Ufa-Wochenschau war dann die einzige unter NS-Kontrolle gestellte Produktion. Gegen Ende des Krieges wurden darin auch Niederlagen als Siege verkauft. Das merkte das Publikum aber auch, oder?
Georg Eckert: „Nicht jedes Publikum vertraute ihr gleichermaßen. Überhaupt ist es quer durch alle Medien und Genres eine große Herausforderung für die Forschung, die Wirksamkeit der NS-Propaganda zu erfassen. Hätte man Meinungsumfragen der NS-Zeit, könnte man ihnen aus naheliegenden Gründen kaum trauen. Auch die oft angeführten Berichte des Sicherheitsdienstes des Reichsführers SS müssen quellenkritisch gelesen werden. Ohnehin lässt sich kaum isoliert beurteilen, ob die mit Kriegsbeginn gleichgeschaltete Wochenschau oder Durchhaltefilme wie „Kolberg“ oder der Rundfunk oder die Tagespresse oder Magazine oder anderes die „Kriegsmoral“ besonders stärkte oder mit Absehbarkeit der Niederlage und der größeren Reichweite alliierter Medien eher schwächte. Allerdings stellten sich bei der Wochenschau gewisse Abnutzungseffekte ein.
Die Zuschauer wurden des längst auf politische Propaganda reduzierten Programms eher überdrüssig, sei es, weil die Ausgaben für eigene Wochenschau-Kinos auf bis zu 45 Minuten ausgedehnt wurden und die verordneten Wochenschauen den Beginn des ersehnten Unterhaltungsfilms immer weiter hinauszögerten, sei es, weil die Glaubwürdigkeit desto rapider schwand, je mehr offenkundige Niederlagen als Siege verkauft wurden. Goebbels hatte deshalb für eine realitätsnähere Darstellung plädiert, darin allerdings bei Hitler kein Gehör gefunden. Daran, dass sich beide persönlich mit Details einzelner Ausgaben befassten, ist die Bedeutung des Mediums abzulesen. Die hochprofessionelle Produktion, in der wirkungsvolle Effekte später eher über den suggestiven Zusammenschnitt als über die zurückgenommenen Sprecher entstanden, hat zugleich für eine enorme Wirksamkeit bis heute gesorgt. Selbst Dokumentationen über die NS-Zeit oder über den Zweiten Weltkrieg greifen vielfach unkommentiert auf Wochenschau-Material zurück.“
Die Wochenschau befand sich auch nach dem Krieg in Staatsbesitz und diente der Regierung Adenauer zur Steuerung der öffentlichen Meinung. Sie war sozusagen das Schaufenster des Wirtschaftswunders. Wollte man damit dem Ausland das neue Deutschland verkaufen?
Georg Eckert: „Dass die Öffentlichkeit informiert respektive die Öffentliche Meinung irgendwie gelenkt werden müsse, war eine Grundannahme, die bereits die Besatzungsmächte teilten. Unter ihrer Hoheit wurden neue Wochenschauen produziert: in Ostdeutschland (DEFA), aber mit Umerziehungsabsicht ebenso in den westlichen Besatzungszonen, unter anderem in München (USA) und Baden-Baden (Frankreich). Die Neue Deutsche Wochenschau GmbH in Hamburg (im heutigen Warburg-Haus) produzierte ab 1949 Sendungen, in denen ebenfalls viel Kontinuität festzustellen ist. Leitend war allerdings nicht mehr die NS-Ideologie, vielmehr dominierte auf beiden Seiten des Eisernen Vorhangs die Logik des Kalten Kriegs die Berichte. Weiterhin gab es Potpourris mit Politik, Sensationen aller Art und Unterhaltung, die allesamt im Sinne des Systemkonflikts erzählt wurden.
Die Bundesregierung förderte die „Neue Deutsche Wochenschau“, „Der Augenzeuge“ hingegen belieferte ostdeutsche Kinos; schon der Sprache halber war die Wirkung eher nach innen als nach außen beabsichtigt. Die Programme wandten sich an ein deutsches Publikum, das sie von den Vorzügen der parlamentarischen Demokratie respektive des Kommunismus überzeugen sollten, ein Bericht von der Pariser Modenschau illustrierte dann die kapitalistische Konsumkultur. Nur kam im Westen eben rasch ein Pluralismus auf: Die „Fox Tönende Wochenschau“ beispielweise war kommerziell, überhaupt wurden Unterhaltungsthemen für junge Kinobesucher wichtiger.“
Die Ära der Wochenschau endete mit dem Beginn des Fernsehens. Warum?
Georg Eckert: „In der Geschichte der Wochenschauen ist zu beobachten, dass Aktualität zu einem immer wichtigeren Anliegen wurde: Einst über mehrere Monate hinweg ausgestrahlt, erschienen sie längst wöchentlich oder sogar in noch dichterer Folge. Doch der Erfolg trug den Niedergang schon in sich – aktueller als die in immer mehr Wohnzimmer ausgestrahlten täglichen Fernsehnachrichten konnten die Wochenschauen unmöglich sein. Die „Tagesschau“ verdrängte die „Wochenschau“, so wie Nachrichtensendungen mittlerweile digitalen Tickern hinterherlaufen.
Außerdem war in Deutschland mit der Gründung des ZDF im Jahre 1961, ein zweiter Sender neben der ARD verfügbar, bald bauten auch die Dritten Programme ein breites Angebot von Information bis Unterhaltung auf. Längst zogen die Wochenschauen zudem Kulturkritik auf sich. Hans Magnus Enzensberger attackierte das zunehmend in Entertainment übergehende Format, das „publizistisch ohne Wert“ und „ein Instrument zur Lähmung, nicht zur Entfaltung des Bewusstseins“ sei.“
Heute werden alte Wochenschauen natürlich auch in der Forschung genutzt. Wo lagern die denn heute, und wie kommt man denn da ran?
Georg Eckert: „Ein zentrales Archiv sämtlicher Wochenschauen gibt es nicht, weder analog noch digital. Letzteres ist allerdings in Arbeit. Die Überlieferungslage ist komplex. So sind die Wochenschau-Ausgaben aus dem Zweiten Weltkrieg im Bundesarchiv einzusehen, das auch über viel Material aus der Zeit vor 1939 verfügt und teilweise im „Digitalen Lesesaal“ angesehen werden kann. Ausgaben nach 1945 sind aus Copyright-Gründen meist nicht online verfügbar. Die „Neue Deutsche Wochenschau“ wiederum ist vollständig bei einem kommerziellen Anbieter verfügbar, und zwar beim ehemaligen Produzenten, der als GmbH fortbesteht. „Der Augenzeuge“ wiederum ist beim Filmverleih angesiedelt, der die Produktion der DEFA auswertet.“
Uwe Blass
 Dr. Georg Eckert – © Mathias Kehren
Dr. Georg Eckert – © Mathias KehrenÜber Dr. Georg Eckert
Dr. Georg Eckert studierte Geschichte und Philosophie in Tübingen, wo er mit einer Studie über die Frühaufklärung um 1700 mit britischem Schwerpunkt promoviert wurde, und habilitierte sich in Wuppertal. 2009 begann er als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fach Geschichte und lehrt heute als Privatdozent in der Neueren Geschichte.
Weiter mit:




Kommentare
Neuen Kommentar verfassen